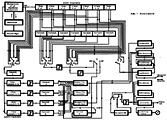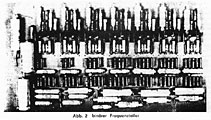Sonderdruck aus „Rundfunk
und Fernsehen“ 1964, Heft 2
Neuentwicklungen auf dem Gebiete der Rundfunk und Fernsehtechnik
Ein neuartiger elektronischer Klang- und Geräuscherzeuger
Von Ernst Schreiber
(Rundfunk- und Fernsehtechnisches
Zentralamt der deutschen Post, Berlin)
Im Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamt der deutschen Post, Berlin-Adlershof,
wurde für die Erzeugung elektronischer Klänge und Geräusche
ein neuartiges elektronisches Gerät entwickelt , das in erster Linie
für den Bedarf von Rundfunk- und Fernsehstudios, für Spiel-
und Trickfilmstudios sowie für Opernhäuser und Theater bestimmt
ist. Das Instrument ist für individuelle Klangsteuerung ausgelegt,
das heißt, es wird von einem Musiker (in den meisten Fällen
wird es der Komponist sein) gespielt. Gesteuert werden Tonhöhe, Klangfarbe
und Lautstärke. Klangerzeuger sind ein Steuergenerator mit subharmonischen
und binären Frequenzteilern mit unterschiedlicher Ausgangswellenform
sowie ein Rausch- und ein Sinusgenerator. Die Formung der Klänge
und Geräusche erfolgt im Gerät durch Formantfilter, umschaltbare
Hoch- und Tiefpässe, Abklingeinrichtung, Chormodulation und Frequenzmodulation
(Vibrato). In Verbindung mit der Einrichtung eines beim Rundfunk üblichen
Produktionsstudios erfolgt die weitere Verarbeitung durch Hallplatte,
Iteration, Magnetbandgerät mit veränderbarer Bandgeschwindigkeit,
Synchronisation usw. Der Klangerzeuger hat unter den international bekannten
elektronischen Instrumenten keine Parallele. In seiner Anwendung und Wirkung
ist er in Bezug auf die Verwendung subharmonischer Tonreihen teilweise
mit dem Mixturtrautonium von O. Sala vergleichbar. Technisch gesehen wurden
dagegen völlig neue Wege beschritten, die gegenüber der vor
Jahren entstandenen und sehr diffizilen Apparatur von O. Sala eine sehr
große Betriebssicherheit gewährleisten. Das Gerät ist
so eingerichtet, daß es jeder klavierspielende Musiker nach kurzer
Einarbeitungszeit bedienen kann. In der Mehrzahl aller Fälle wird
es der Komponist selbst sein, der hier erstmalig selbst nach seinen eigenen
Vorstellungen und Ideen arbeiten kann, ohne von anderen Musikern abhängig
zu sein. An Hand eines Klangkataloges werden dem Komponisten für
jeden Anwendungsbereich der Erzeugung von Klang- und Geräuschstrukturen
einige Grundeinstellungen vorgegeben. Auf diesen Grundeinstellungen kann
er weiter aufbauen und seine eigenen Vorstellungen und Ideen einarbeiten.
Im folgenden wird der Klang- und Geräuscherzeuger in seinem technischen
Aufbau und in seinem Anwendungsbereich beschrieben:
In Abb.1 wird in einem Blockschaltbild die allgemeine Funktionsfolge des Gerätes veranschaulicht.
Generatoreinheit
mit Manual
Diese Baugruppe beinhaltet den Steuergenerator , eine Impulsformungsstufe
(Schmitt-Trigger) und einen Vibratogenerator. Der Steuergenerator ist
ein besonders dimensionierter Multivibrator. Grundsätzlich unterscheidet
man zwei Arten von Tongeneratoren, und zwar den Kurztongenerator und den
Dauertongenerator. Unter Kurztongenerator werden alle die Tongeneratoren
verstanden, die im Moment des Tastens vom Ruhezustand in den betriebsmäßigen
Zustand versetzt werden, der solange anhält, wie die Taste gedrückt
wird. Dabei ist es gleichgültig, welche Schwingungsform erzeugt wird.
Bei Beendigung der Tastung wird der Ruhezustand wieder hergestellt. Die
Dauertongeneratoren dagegen befinden sich immer im Betriebszustand, das
heißt, daß die Tonfrequenzen ständig erzeugt werden,
und zwar solange, wie das Instrument eingeschaltet ist.
Der hier angewandte Steuergenerator gehört zur Gruppe der Kurztongeneratoren.
An diesen Generatoren werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Er muß
beim Tasten sofort und ohne Einschwingvorgang in die gewünschte Frequenz
(Tonhöhe) einspringen. Desgleichen dürfen auch keine Zieherscheinungen
auftreten. Für den Ausschwingvorgang gelten die gleichen Bedingungen.
Die erzeugte Ausgangswellenform ist ein Impuls, der in einer Triggerstufe
in eine Rechteckschwingung umgewandelt wird, die zur Ansteuerung eines
binären, sowie von vier subharmonischen Frequenzteilern dient. Mit
dem Vibratogenerator wird die Tonhöhe des Steuergenerators rhythmisch
verändert. Es handelt sich um eine echte Frequenzmodulation. Vibratofrequenz
und Frequenzhub sind von der Registerstaffel aus einstellbar.
Das Instrument ist mit einem Tastenmanual und einer Glissandospieleinrichtung
ausgestattet. Der Frequenzbereich des Steuergenerators entspricht dem
Tastenumfang der Klaviatur von drei Oktaven plus einem Halbton (37 Tasten)
und verläuft von g3 – g6. Die Ausgangsspannung des Steuergenerators
wird über die Triggerstufe zur Steuerung des binären und der
subharmonischen Frequenzteiler verwendet. Der binäre Frequenzteiler
stellt in dieser Schaltung in Verbindung mit dem Steuergenerator den eigentlichen
Hauptgenerator dar. Mit den von diesen Teilern abgegebenen Tonspannungen
werden über entsprechende Klangformungselemente die Melodienstimmen
erzeugt.
Binärer
Frequenzteiler
Der binäre Frequenzteiler hat insgesamt ein Untersetzungsverhältnis
von 1/2 : 1/128. Zusammen mit dem 3-Oktaven-Tastenumfang der Klaviatur
ergibt sich insgesamt gesehen ein Tonumfang von zehn Oktaven plus einem
Halbton. Die erzeugten Frequenzen der Teilerstufen 1 bis 7 stehen im ganzzahligen
Verhältnis zum Steuergenerator (1/2 – 1/4 – 1/8 –
1/16 – 1/32 – 1/64 – 1/128). Diese sieben im Oktavverhältnis
zueinander stehenden Frequenzen werden gleichzeitig erzeugt. Bezeichnet
man zum Beispiel die höchste Teilerfrequenz entsprechend der Orgelregistrierung
als 1´ Registerlage, so stehen durch die Teilerstufen 2 bis 7 gleichzeitig
noch folgende Registerlagen zur verfügung: 2´ - 4´ -
8´ - 16´ - 32´ - 64´. Die zusätzlichen Registrierungsmöglichkeiten,
auch mit unterschiedlichen, sich voneinander absetzenden Klangfarben,
bedeutet eine erhebliche Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten
des Instrumentes. Jede Teilerstufe des binären Frequenzteilers liefert
zwei Ausgangsspannungen mit unterschiedlicher Ausgangswellenform, so daß
der binäre Frequenzteiler insgesamt 14 Ausgänge hat.
Subharmonischer Frequenzteiler
Dem Hauptgenerator (Steuergenerator und binärer Frequenzteiler) sind
nun vier weitere Nebengeneratoren zugeordnet, die von ihm synchronisiert
werden. Diese Nebengeneratoren liefern ausschließlich subharmonische
Frequenzen und sind ganzzaglige Teiler der Frequenz des Hauptgenerators.
Die subharmonische Reihe ist daher das intervallgetreue Spiegelbild der
bekannten Obertonreihe. An eine subharmonische Synchronisationsvorrichtung
werden sehr hohe Anforderunen gestellt. Das einmal eingestellte subharmonische
Teilungsverhältns muß über den ganzen kontinuierlichen
Frequenzbereich von 10 Oktaven erhalten bleiben. Je nach Einstellung des
Schalters für die Wahl des Teilungsverhältnisses kann die subharmonische
Tonreihe zwischen 1/2 und 1/16 erzeugt werden. Nach einem neuen hier zur
Anwendung kommenden Verfahren (5) können die subharmonischen Tonreihen
beliebig erweitert werden. Je nach Stellung des Schalters für die
Wahl der Triggerfrequenzen werden die Impulse für den Eingang des
subharmonischen Frequenzteilers den Teilerstufen 1 bis 6 des binären
Frequenzteilers bzw. die höchste Triggerfrequenz dem Steuergenerator
entnommen. Im übrigen ergibt sich durch die gleichzeitige Erzeugung
von 7 Registerlagen die Möglichkeit, subharmonische Frequenzen zu
erzeugen, deren Teilungsverhältnisse weit höher liegen als 1/2
bis 1/6. Werden zum Beispiel die Triggerimpulse einer Teilerstufe des
binären Frequenzteilers (Hauptgenerator) entnommen, der gerade zur
Klangformung eingeschaltet ist, so entstehen subharmonische Teilungsverhältnisse
von 1/4 bis 1/32, wobei die ungeradzahligen Verhältnisse fehlen.
Die Ausgangsspannung jedes subharmonischen Teilers wird einem Lautstärkeregler
zugeführt, um die Lautstärke jeder Stimme der 4fachen subharmonischen
Mixtur zu dosieren. Über Trennstufen werden die Mixturstimmen den
Klangformungselementen zugeführt. Für jede Mixturstimme ist
ein separates Hochpaß- bzw. Tiefpaßfilter mit veränderlichen
Grenzfrequenzen vorgesehen. Wie aus dem Blockschaltbild zu erkennen ist,
kann zum Beispiel eine Mixturstimme über ein Hochpaßfilter
eine zweite Stimme über ein Tiefpaßfilter, die dritte Stimme
über eine Bandpaßfilteranordnung, die nach der Mel-Skala aufgebaut
ist und die vierte Stimme über die Formantfilter des Hauptgenerators
geleitet werden.
Filter-Summierungsschaltung
Die Ausgänge aller Filteranordnungen, wie auch der Ausgang des Ringmodulators,
werden einer Filtersummierungsschaltung zugeführt. Hier werden über
Dosierungswiderstände die einzelnen Filterausgangsspannungen auf
einen bestimmten Pegel gebracht und untereinander entkoppelt. Nach einer
Verstärkerstufe und einem Impedanzwandler werden die Tonspannungen
einer druckabhängigen Lautstärkenregeleinheit zugeführt.
Druckabhängige
Lautstärkenregelung
Mit dem Manual und der Glissando-Spieleinrichtung mechanisch gekoppelt
ist die druckabhängige Lautstärkenregelung. Je nachdem wie weit
eine Manualtaste heruntergedrückt wird, ändert sich der Pegel
von Null bis zum Maximalwert. Die mit dem Lautstärkenregler vorzunehmende
Amplitudenregelung dient aber auch gleichzeitig zur Erzielung bestimmter
Klangeffekte wie An- und Abschwellen des Tones, Einblendungen, willkürliche
Gestaltung der Tonansatzvorgänge. Die Regeleinrichtung ermöglicht
stufenlose und gleitende Änderung der Tonamplitude, arbeitet dabei
aber völlig geräuschfrei. Außerdem läßt sie
sich trägheitsfrei betätigen. Selbstverständlich muß
sich der Spieler des Instrumentes damit erst vertraut machen. Ein normales
Spiel auf den Tasten, wie zum Beispiel beim Klavierspiel, ergibt nicht
den gewünschten Effekt. Die Regeleinrichtung ist mit einer neuartigen
Lichtsteuerung ausgestattet, die alle Anforderungen erfüllt. Die
Regelkurve ist im gewissen Umfange einstellbar. Die so in ihrer Amplitude
geregelten Tonspannungen werden entweder direkt dem Gesamtlautstärkenregler
zugeführt oder bei Bedarf über eine Abklingeinrichtung.
Rhytmisierungseinrichtung
Für das Instrument wurde eine Rhytmisierungseinrichtung entwickelt.
Sie zerhackt einen Dauerton in kurze Einzeltöne, wodurch staccatoähnliche
Klänge entstehen, die bis zur Grenze der Tonerkennbarkeit in Stufen,
aber auch gleitend, verkürzt werden können. Die Rhytmisierungsfrequenz
ist jederzeit reproduzierbar und kann somit in der Partitur des komponisten
vermerkt werden.
Abklingeinrichtung
In dieser Stufe werden Dauertöne in abklingende Töne umgewandelt.
Die Dauer des Abklingvorganges kann in weiten Grenzen geregelt werden.
Mit dieser Einrichtung werden zum Beispiel gezupfte Klänge erzeugt.
Abklingende subharmonische Mixturen ergeben metallische Klänge, wobei
je nach Zusammensetzung der frequenzvariablen Mixturen eigenartige neue
Eindrücke entstehen.
Ringmodulator
Mit Hilfe des Ringmodulators werden ebenfalls interessante Klang- und
Geräuschstrukturen erzeugt. Die zu modulierenden Spannungen (Sinustöne,
Rauschen usw.) werden dem Ringmodulator von außen zugeführt.
Die Modulationsspannung ist ein Sägezahn, dessen Frequenz von der
Klaviatur aus oder mittels der Glissando-Spieleinrichtung gesteuert werden
kann.
Chormodulation
Mit dieser Modulationsart kann einer einzelnen Stimme oder auch einem
Klanggemisch eine Chorwirkung zugeordnet werden (ähnlich der Wirkung
einer großen Besetzung gleicher Instrumente). Spielen zum Beispiel
in einem Orchester mehrere Geiger die erste Stimme, so hört man deutlich
die Chorwirkung heraus, weil es auch dem besten Geiger nicht gelingt,
die genaue Tonhöhe gleichzeitig mit den anderen zu spielen. Es sind
immer geringe Stimmungsunterschiede vorhanden. Da das menschliche Ohr
die entstehenden Schwebungen bis zu einer Dauer von 24 sec. noch heraus
hört, hat man deutlich den Eindruck, daß hier ein Geigenchor
spielt. Diese Chorwirkung ist ein wesentliches Merkmal der Ästhetik
und für die Klangwirkung des Orchesters von großer Bedeutung.
Wäre dies nicht der Fall, so brauchte auch das größte
Orchester nur einen einzigen ersten Geiger (zum Beispiel den Konzertmeister).
Um die gewünschte Lautstärke der ersten Geige im Orchester zu
erreichen, brauchte der Konzertmeister nur über ein Mikrofon zu spielen,
dessen Tonspannungen in einem Verstärker genügend verstärkt
über Lautsprecher eingespielt wird. Gegenüber einem Geigenchor
würde diese Maßnahme die Wirkung des Orchesters sehr stark
beeinträchtigen. Die Chorwirkung ist also ein entscheidendes Merkmal
in der Musik.
Zur Erzeugung einer Chormodulation wird ein neues Verfahren angewendet (6), in dem das fertige Klanggemisch mit einer Spezialmodulation versehen wird. Dieses Klanggemisch wird einer Schaltungsanordnung zugeführt und in mindestens drei Kanälen getrennt verarbeitet. Im Kanal I wird das Klanggemisch nicht moduliert. Im Kanal II wird eine Frequenzmodulation (Phasenmodulation) vorgenommen, deren Modulationsfrequenz bei etwa 0,1 –1 Hz liegt. Im Kanal III wird ebenfalls eine Frequenzmodulation durchgeführt, die eine Modulationsfrequenz von etwa 0,5 – 2 Hz aufweist. Nach dieser getrennten Verarbeitung des Eingangssignals werden die Signalamplituden dosiert und über eine Mischeinrichtung zu einem Gesamtklang additiv vereinigt. Durch Erhöhung der Zahl der Kanäle kann die Wirkung der Chormodulation noch verstärkt werden.
Trennstufen
Die Trennstufen, die an verschiedenen Punkten der Gesamtschaltung des
Instrumentes eingefügt sind, haben im wesentlichen die Aufgabe, die
Ausgangsspannungen rückwirkungsfrei zu entnehmen. Gleichzeitig dienen
sie auch als Impedanzwandler.
Die elektronische Klangformung im stationären Zustand
In der Akustik wird der stationäre Klang als eine Lautäußerung
definiert, die von Tonhöhe, Lautstärke und Zusammensetzung von
Grundton und Obertönen abhängt, wobei die Zahl der Schwingungen
pro Sekunde der Obertöne ganze Vielfache des Grundtones ausmacht.
Der Grundton und die Obertöne werden zueinander als harmonische oder
Teiltöne bezeichnet und erhalten fortlaufende Ordnungszahlen, wobei
der Grundton der erste Teilton ist. In einem Linienspektrum werden die
Teilkomponenten der Klänge dargestellt. Jede Linie bedeutet einen
Teilton und ihre Länge die Intensität des Teiltones. Die einfachste
Lautäußerung stellt danach der einzelne sinusförmige Ton
dar. Er ist musikalisch völlig reizlos und wird allein als Sinuston
nicht wahrgenommen, da er im Ohr noch eine zusätzliche Reihe harmonischer
Obertöne erzeugt. Die musikalischen Lautäußerungen der
herkömmlichen Instrumente stellen in keinem Falle diskrete Sinusschwingungen
dar. Sie sind immer Klänge, die einen mehr oder weniger großen
Gehalt an Obertönen unterschiedlicher Intensität besitzen.
Mit dieser von Fourier aufgestellten Definition wird jedoch nur der äußere, physikalische Vorgang, der beim Hören eine Klangempfindung hervorruft, erfaßt. Untersuchungen haben ergeben, daß die Hörempfindung nicht nach Art einer Obertonanalyse erfolgt, sondern an deren Stelle eine diffuse Erregungszone tritt, deren Wirkung als psycho-physisches Farbgeräusch bezeichnet wird. Dabei verbreitert sich jede Spektrallinie zu einer Resonanzkurve, die nach Hermann mit Formanten bezeichnet werden. Dieses tatsächlich gehörte „Bandenspektrum“ kann durch eine Serie von abgestimmten elektrischen Formantkreisen bestimmter Bandbreite dargestellt werden. Sie entsprechen den physiologischen Resonatoren, zum Beispiel der Mund- und Rachenhöhle, die ebenfalls gedämpft sind. Das Fouriersche Theorem hat also für die musikalische Akustik nur bedingt Gültigkeit, da es das psycho-physische Farbgeräusch nicht erfassen kann. Dies wird dadurch schon deutlich, daß eine Umkehrung der Analyse zur Synthese trotz hohem technischen Aufwand keine Klänge von traditionellen Musikinstrumenten ergeben, die auch nur annähernd gleichwertig wären. Dies ist auch der Grund dafür, daß elektronische Musikinstrumente mit additiver Klangformung (Klangsynthese) nicht befriedigen konnten. Von den zahlreichen Methoden, elektrische Töne klanglich zu färben, hat sich die Stoßerregung von elektrischen Resonanzkreisen durch Kippschwingungen als besonders vielseitig erwiesen. Bei der Klangformung in dem neuen Klang- und Geräuscherzeuger wird von diesem Prinzip weitgehend Gebrauch gemacht. Außer diesen schwingungsfähigen Formantfiltern (Resonanzkreisen) werden noch RC-Filter als Hochpässe, Tiefpässe und kombiniert mit Resonanzkreisen eingesetzt. Eine aus 14 Bandpaßfiltern bestehende Filteranordnung, die nach der Mel-Skala aufgebaut ist, vervollständigt die umfangreichen Klangformungselemente dieses Instrumentes. Durch die gleichzeitige Erzeugung von sieben variablen Registerlagen, die im Oktavverhältnis zueinander stehen, können besondere Klangfarben nach der Klangformung noch additiv zugesetzt werden.
Auf die Formanttheorie und die technische Realisierung bei der elektrischen Klangformung soll hier nicht näher eingegangen werden. Zum besseren Verständnis der Klangformung mittels Stoßformanten, die in dem neuen Instrument vornehmlich zur Anwendung kommt, soll dieser Teil der Formanttheorie kurz erläutert werden, weil dies für den Komponisten von besonderer Bedeutung ist (1 – 2 – 3 – 4). Die Anwendung von Stoßformanten wurde erstmals von Trautwein vorgeschlagen. Wirkt eine Stoßfrequenz – in der Folge mit „SF“ bezeichnet – auf einen elektrischen Schwingungskreis ein, so wird dieser durch den Spannungsstoß erregt und klingt in seiner Eigenfrequenz ab. Wiederholt man diese Stoßerregung periodisch, so entstehen aufeinander folgende abklingende Eigenfrequenzen – im folgenden mit „EF“ (1 – 2) bezeichnet. Die der EF am nächsten liegenden Teiltöne sind auch die jeweils stärksten des Klangspektrums. Wichtig ist jedoch, daß die Resonanzkreise eine breite, diffus erregte Zone aufweisen. Im Mittel ist die Bandbreite der Resonanzkreise bei den Vokalklangfarben etwa 400 Hz. Ist die Bandbreite zu schmal, dann geht die Klangfarbenempfindung verloren und das Ohr hört die einzelnen Teiltöne der Fourier-Analyse. Eine so erzeugte elektroakustische Klangfarbe wird vom Ohr als vokalartig empfunden. Variiert man die EF, so sind sehr deutlich der Reihe nach die Vokale u, ä, a, e, i zu hören. An die Stelle des unscharfen Formantbegriffes tritt der physikalisch festumrissene Begriff der stets gedämpften EF. Das Verhältnis EF : SF ist ganz beliebig und im allgemeinen unharmonisch. Dennoch treten in der Analyse stets nur reine ungedämpfte harmonische Sinusschwingungen auf.
In dieser Betrachtungsweise erledigt sich von selbst der Streitfall Helmholtz und Hermann, der darum ging, ob die Formanten sich harmonisch zum Grundton aufbauen oder unbeweglich eine feste Frequenz haben, die auch unharmonisch zum Grundton liegen kann. Beide Auffassungen erhalten Gültigkeit, wenn man als Formanten nicht eine diskrete Frequenz, sondern einen Frequenzbereich annimmt. Daraus folgt die wichtige Erkenntnis, daß eine Konstanz der EF zugleich eine Konstanz der Klangfarbenempfindung ist. Das Ohr reagiert also nicht analytisch. Obgleich die relativen Amplituden und Ordnungszahlen der Teiltöne bei veränderlicher SF im Formantbereich ständig wechseln, bleibt die Klangfarbe erhalten, sofern der Formant nicht überspielt wird. Wird die SF gleichzeitig mit EF so variiert, daß das Verhältnis konstant bleibt, dann bleibt auch das Teiltonspektrum gleich. Dennoch wechselt die Klangfarbe, da die EF sich ändert. Hieraus ergeben sich nun große klangliche Möglichkeiten. Man kann die SF bei konstanter EF in weiten Grenzen variieren, ohne daß sich die Klangempfindung ändert. Andererseits kann die Klangfarbe jedoch leicht gewechselt werden, indem man die EF der elektrischen Resonanzkreise veränderlich macht.
Anwendungsbereich
des neuen Instrumentes
Was können der Komponist und der Musiker mit diesem neuen Instrument
nun anfangen? Man kann es als das Kernstück eines Studios für
elektronische Klang- und Geräuscherzeugung bezeichnen. Das Instrument
wurde nicht für konzertante Zwecke entwickelt. Erst mit den in vielen
Studios vorhandenen Zusatzeinrichtungen (Hallplatte, Magnetbandgerät,
Iteration, Synchronisierungen, Mischeinrichtungen im Regiepult usw.) werden
die gewünschten Effekte und optimalen Wirkungen erzielt.
Mit diesem Instrument wurden bereits Klang- und Geräuscheffekte für
eine Reihe von Trick- und Spielfilmen produziert. Insbesonders wurde bei
Puppen- und Zeichentrickfilmen die Handlung ausschließlich durch
stilisierte Klänge und Geräusche illustriert.
Bei den Spielfilmen werden meist bei bestimmten Szenen elektronisch erzeugte
Klang- und Geräuschstrukturen unterlegt, um zum Beispiel bestimmte
Spannungen bei den Filmbetrachtern zu erzeugen, die auf einen kommenden
Höhepunkt in der Handlung hinweisen, zum Beispiel um den Start eines
Raumschiffes akustisch darzustellen. Ob Maschinengeräusche in einer
Fabrikhalle oder im freien Raum oder ob nie gehörte Geräusche
von anderen Planeten dargestellt werden sollen, alles kann man mit diesem
Instrument erzeugen. Der Fantasie des Komponisten sind keine Grenzen gesetzt.
Dies alles gilt natürlich auch für Hörspiele im Rundfunk
sowie im Theater.
Aber auch für rein musikalische Zwecke läßt sich das Instrument verwenden. So wurden schon einige Unterhaltungstitel rein elektronisch mit diesem Instrument produziert, die großen Anklang fanden. Auch zusammen mit konventionellen Musikinstrumenten wurde das elektronische Instrument eingesetzt. Dabei wird im allgemeinen so verfahren, daß erst die Orchesteraufnahme produziert und dann im Studio die elektronischen Stimmen nachträglich synchronisiert werden. Da das elektronische Instrument der Normung entsprechend auf 440 Hz gestimmt ist, wäre ein direktes Zusammenspiel von Orchestern bzw. Einzelinstrumenten höherer Stimmung als 440 Hz kaum möglich. Bei dem nachträglichen Synchronisierungsvorgang kann jedoch mittels eines Magnetbandgerätes mit veränderbarer Bandgeschwindigkeit jede Orchesterstimmung auf 440 Hz umgesetzt werden, so daß kein Stimmungsunterschied zwischen der Orchesterstimmung und der des elektronischen Instrumentes mehr besteht. Gerade das Zusammenspiel von Orchester und elektronischem Instrument ergibt neue und reizvolle musikalische Eindrücke, insbesondere bei der Anwendung subharmonischer Tonreihen, die ja, wie bekannt, in der Natur nicht vorkommen und somit neuartige Eindrücke hervorrufen.
Abschließend
wäre noch zu ergänzen, daß das Instrument in seinem Aufbau
dem modernsten Stand der Technik entspricht. Gedruckte Schaltungen, Karteieinschübe
wie bei elektronischen Rechenmaschinen, kommen auch hier zur Anwendung.
Das Gerät ist zu 98% mit Halbleiterbauelementen bestückt. Nur
an den Stellen der Schaltung, wo es auf eine genaue Frequenzkonstanz ankommt,
werden zur Zeit noch einige Röhren eingesetzt. Die Abb. 3-5 zeigen
ein Modell, dessen Spieltisch aus Holz gefertigt wurde.
Bei der weiteren Entwicklung wird das Gerät durch einen Orgelteil
ergänzt und kann auch in Metallbauweise, mit Kunststoffabdeckung,
ausgeführt werden.
Abbildungen:
Literaturverzeichnis
Sala,O: Elektronische Klanggestaltung mit dem Mixturtrautonium, Gravesano,
Juli 1955, 78-87
Sala, O: Experimentelle und theoretische Grundlagen des Trautoniums, Frequenz
2 (1948), 315-322, 3 (1949), 13-19
Trautwein: Perspektiven der musikalischen Elektronik, Gravesano, Juli
1955, 103-110
Schreiber, E: Grundlagen der elektronischen Klangerzeugung, Radio und
Fernsehen 4 (1955), H. 22, S. 680-684
Patent DWP 25634
Patent DWP 23817
[Abschrift nach Originalunterlagen / Manfred Miersch, 2002]
* www.subharchord.de